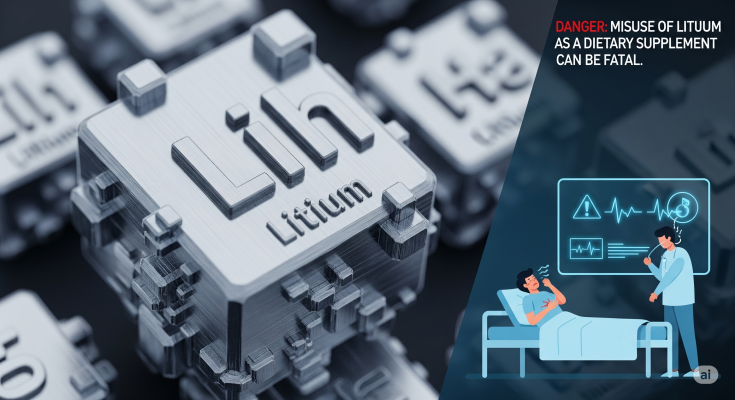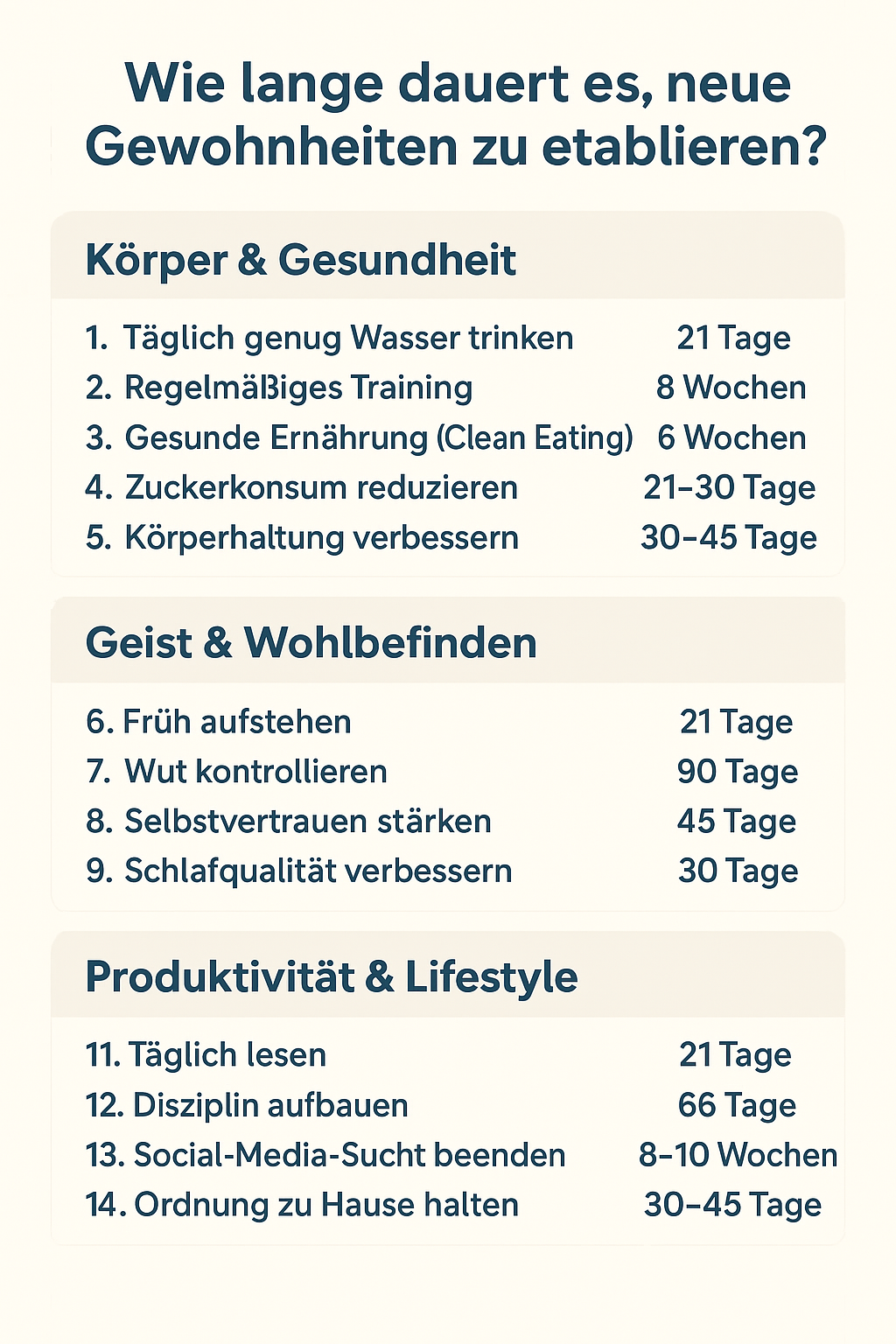Die Wahrheit über das umstrittene Nahrungsergänzungsmittel!
Einleitung: Lithium – Das zweischneidige Schwert
Das Element Lithium präsentiert sich in der modernen Gesundheitsdebatte mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Auf der einen Seite steht es als hochpotentes, verschreibungspflichtiges Medikament, das seit Jahrzehnten als Goldstandard in der Behandlung von bipolaren Störungen gilt und nachweislich Leben rettet.1 Auf der anderen Seite wird es im Internet und in Kreisen der alternativen Medizin als niedrig dosiertes „Nahrungsergänzungsmittel“ – meist in der Form von Lithiumorotat – angepriesen, das von der Stimmungsaufhellung bis hin zur Prävention von Demenzerkrankungen wahre Wunder wirken soll.4
Diese fundamentale Dichotomie führt zu erheblicher Verwirrung und wirft entscheidende Fragen auf. Handelt es sich bei Lithium um ein essenzielles Spurenelement, von dem viele Menschen einen Mangel aufweisen, oder um eine potenziell gefährliche Substanz, die ausschließlich unter strenger ärztlicher Aufsicht angewendet werden darf?.6 Die Tatsache, dass Lithiumorotat in den USA frei als Supplement verkauft wird, während es in der Europäischen Union nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist, verstärkt diese Unsicherheit zusätzlich.
Dieser Artikel liefert eine umfassende und wissenschaftlich fundierte Analyse, um Klarheit in diese komplexe Thematik zu bringen. Es werden die potenziellen Vorteile von niedrig dosiertem Lithium beleuchtet, die erheblichen und gut dokumentierten Risiken detailliert dargestellt und die komplexen rechtlichen Gründe aufgeschlüsselt, warum Lithium in der EU nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden darf.9 Ziel ist es, eine differenzierte Perspektive zu bieten, die es den Lesern ermöglicht, die Versprechungen von den Fakten zu trennen und fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen.
Die zwei Welten des Lithiums: Rezept vs. Supplement
Um die Debatte um Lithium zu verstehen, ist es unerlässlich, zwischen seinen beiden Hauptanwendungsformen zu unterscheiden: dem hochdosierten, verschreibungspflichtigen Arzneimittel und dem niedrig dosierten, als Nahrungsergänzungsmittel vermarkteten Produkt. Diese beiden Formen unterscheiden sich fundamental in ihrer chemischen Zusammensetzung, Dosierung, Indikation, wissenschaftlichen Evidenz und vor allem in ihrem Risikoprofil.1
Das verschreibungspflichtige Arzneimittel liegt meist als Lithiumcarbonat oder Lithiumcitrat vor. Es wird in hohen Dosen von 600 bis 1800 mg Lithiumcarbonat pro Tag verabreicht, was einem Gehalt von 113 bis 338 mg an elementarem Lithium entspricht. Diese Dosierungen sind notwendig, um therapeutische Blutspiegel zur Behandlung schwerer psychiatrischer Erkrankungen wie der bipolaren Störung zu erreichen, für die eine jahrzehntelange, robuste klinische Evidenz vorliegt.1
Im Gegensatz dazu wird Lithium als Nahrungsergänzungsmittel fast ausschließlich in Form von Lithiumorotat angeboten. Die Dosierungen sind hier drastisch niedriger und liegen typischerweise bei 1 bis 20 mg elementarem Lithium pro Tag.4 Es wird für eine breite Palette von unspezifischen Anwendungsgebieten wie die allgemeine Stimmungsunterstützung, Stressreduktion und die Förderung der kognitiven Gesundheit beworben. Die klinische Evidenz für diese Behauptungen ist jedoch äußerst spärlich und umstritten.1
Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Welten des Lithiums gegenüber und dient als Referenzpunkt für die nachfolgenden Analysen.
| Merkmal | Lithiumcarbonat (Arzneimittel) | Lithiumorotat (Nahrungsergänzungsmittel) |
| Chemische Form | Anorganisches Salz | Organisches Salz (Lithium + Orotsäure) |
| Typische Tagesdosis (elementares Lithium) | 113 – 338 mg (oft höher) | 1 – 20 mg |
| Primäre Anwendung | Behandlung bipolarer Störungen, schwere Depressionen, Cluster-Kopfschmerz 14 | Unbelegte Behauptungen: Stimmungsstabilisierung, Neuroprotektion, Stressreduktion 1 |
| Rechtsstatus (EU/Deutschland) | Verschreibungspflichtig (Arzneimittel) 10 | Nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen; als Rezeptur verschreibungspflichtig 10 |
| Rechtsstatus (USA) | Prescription-only (Rx-only) 16 | Over-the-counter (OTC) als Dietary Supplement 17 |
| Erforderliches Monitoring | Zwingend: Regelmäßige Blutspiegelkontrolle, Nieren- & Schilddrüsenfunktion 18 | Keines (was ein Kernrisiko darstellt) 1 |
| Wissenschaftliche Evidenz | Umfangreich, Goldstandard in der Psychiatrie 2 | Sehr begrenzt, hauptsächlich Tierstudien, mangelhafte Humanstudien 8 |
| Hauptrisiken | Nieren- & Schilddrüsenschäden, Toxizität, enger therapeutischer Grat 19 | Unbekannte Langzeitrisiken, potenzielle Toxizität bei unkontrollierter Einnahme, Risiken durch Orotsäure 1 |
Ein zentraler Punkt in der Argumentation für Lithiumorotat ist die Behauptung, dass die organische Orotsäure als Trägermolekül dient, das Lithium effizienter durch die Blut-Hirn-Schranke und in die Zellen transportiert. Dies soll niedrigere und somit sicherere Gesamtdosen ermöglichen.11 Diese Hypothese stützt sich jedoch auf eine sehr dünne wissenschaftliche Grundlage, die hauptsächlich aus älteren und kleinen Studien besteht und nicht durch robuste klinische Daten am Menschen untermauert ist.11
Darüber hinaus konzentriert sich die Debatte oft fälschlicherweise nur auf das Lithium-Ion und ignoriert das Trägermolekül. Die Orotsäure selbst ist jedoch keine inerte Substanz. In einer offiziellen Stellungnahme zu Orotatsalzen hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auf eine potenziell tumorfördernde Wirkung von Orotsäure in tierexperimentellen Studien hingewiesen und den geringen Sicherheitsabstand zwischen der üblichen Aufnahme und den Dosen, die diese Effekte zeigten, bemängelt.21 Dies stellt ein eigenständiges, in der Werbung für Lithiumorotat oft verschwiegenes Risiko dar, das über die bekannten Gefahren des Lithiums hinausgeht. Die Wahl der chemischen Form ist also nicht nur eine Frage der Bioverfügbarkeit, sondern auch eine der Sicherheit des gesamten Moleküls.
Das Potenzial: Warum das Interesse an niedrig dosiertem Lithium?
Trotz der erheblichen Risiken und der kontroversen rechtlichen Lage gibt es plausible wissenschaftliche Gründe für das anhaltende Interesse an niedrig dosiertem Lithium. Diese Gründe speisen sich aus zwei Hauptquellen: vielversprechender präklinischer Forschung zu seinen neuroprotektiven Eigenschaften und faszinierenden epidemiologischen Beobachtungen.
Neuroprotektion: Ein Schutzschild für das Gehirn?
Eine wachsende Zahl von präklinischen Studien, die an Zellkulturen und in Tiermodellen durchgeführt wurden, deutet konsistent darauf hin, dass Lithium bemerkenswerte neuroprotektive, also nervenschützende, Eigenschaften besitzt.2 Diese Effekte scheinen auf komplexen Eingriffen in die zelluläre Biochemie zu beruhen.
Die wichtigsten Wirkmechanismen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Hemmung des Enzyms GSK-3β: Einer der am besten untersuchten Mechanismen ist die Fähigkeit von Lithium, das Enzym Glykogensynthase-Kinase-3β (GSK-3β) zu hemmen. Dieses Enzym spielt eine Schlüsselrolle bei zellulären Prozessen, die mit der Entstehung der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden, insbesondere bei der Bildung von Amyloid-Plaques und der Hyperphosphorylierung des Tau-Proteins, die zum Absterben von Nervenzellen führen.2 Durch die Hemmung von GSK-3β könnte Lithium diesen pathologischen Kaskaden entgegenwirken.
- Förderung von Neurotrophinen: Lithium stimuliert die Produktion von sogenannten neurotrophen Faktoren, insbesondere des Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF). BDNF ist ein Protein, das essenziell für das Überleben, das Wachstum und die Differenzierung von Nervenzellen ist und die neuronale Plastizität fördert.2 Erhöhte BDNF-Spiegel werden mit verbesserter kognitiver Funktion und Resilienz gegenüber neurodegenerativen Prozessen in Verbindung gebracht.
- Weitere zelluläre Effekte: Darüber hinaus scheint Lithium die Autophagie zu fördern, einen zellulären Selbstreinigungsprozess, der beschädigte Zellbestandteile entfernt. Es reduziert oxidativen Stress und Entzündungen im Gehirn und kann in Langzeitbehandlungen sogar zu einer Zunahme des Volumens von Hirnregionen führen, die für Gedächtnis und Emotionen wichtig sind, wie dem Hippocampus und der Amygdala.2
Diese vielfältigen Mechanismen nähren die wissenschaftliche Hoffnung, dass niedrig dosiertes Lithium in Zukunft möglicherweise präventiv oder therapeutisch bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson eingesetzt werden könnte.23 Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung zu betonen, dass es sich hierbei um vielversprechende Forschung handelt, die größtenteils aus Labor- und Tiermodellen stammt. Eine Übertragung auf den Menschen und die Etablierung als klinische Anwendung stehen noch aus und erfordern weitere, rigorose Studien.23
Stimmungsaufhellung aus dem Wasserhahn? Die epidemiologische Evidenz
Die zweite Quelle des Interesses an niedrig dosiertem Lithium sind epidemiologische Studien, die einen verblüffenden Zusammenhang aufzeigen. Zahlreiche ökologische Untersuchungen aus verschiedenen Teilen der Welt, darunter Österreich, Japan, die USA, Griechenland und Litauen, haben eine konsistente statistische Korrelation festgestellt: In Regionen, in denen das Trinkwasser von Natur aus höhere Konzentrationen an Lithium aufweist, sind die Suizidraten in der Bevölkerung signifikant niedriger.26
Eine umfassende Meta-Analyse, die diese Einzelstudien zusammenfasste, bestätigte diesen Zusammenhang und kam zu dem Schluss, dass ein höheres natürliches Lithiumlevel im Trinkwasser mit einem signifikant reduzierten Suizidrisiko in der Allgemeinbevölkerung assoziiert ist.28
Diese Beobachtungen haben zu der Hypothese geführt, dass Lithium, selbst in Spurenkonzentrationen, eine stimmungsstabilisierende und antisuizidale Wirkung auf Bevölkerungsebene haben könnte. Befürworter von Lithium-Supplementen nutzen diese Studien häufig als zentrales Argument. Sie postulieren, Lithium sei ein essenzielles Spurenelement, von dem viele Menschen in modernen Gesellschaften einen Mangel hätten, der durch Supplementierung behoben werden könne.6
Diese Argumentation ist jedoch mit einem gravierenden Kategorienfehler behaftet. Die Konzentrationen in den Trinkwasserstudien sind extrem niedrig und bewegen sich im Mikrogramm-Bereich (Millionstel Gramm) pro Liter. Diese Spurenmengen werden über ein ganzes Leben hinweg langsam und kontinuierlich aufgenommen.26 Dies ist pharmakokinetisch und toxikologisch nicht mit der täglichen Einnahme einer konzentrierten Dosis im Milligramm-Bereich (Tausendstel Gramm) aus einer Kapsel vergleichbar. Der Sprung von der epidemiologischen Beobachtung im Trinkwasser zur Empfehlung einer kommerziellen Pille ist wissenschaftlich nicht haltbar und ignoriert die fundamentalen Unterschiede in Dosis, Verabreichungsform und Aufnahmegeschwindigkeit.
Die akademische Debatte über eine mögliche Anreicherung des Trinkwassers mit Lithium, wie sie von einigen Forschern als Public-Health-Maßnahme diskutiert wird, impliziert stets eine staatlich kontrollierte, streng regulierte und überwachte Maßnahme für die gesamte Bevölkerung.31 Die Supplement-Industrie instrumentalisiert diese Debatte, um den unkontrollierten Verkauf eines kommerziellen Produkts an Einzelpersonen zu legitimieren. Hier wird ein wissenschaftliches Konzept für ein kommerzielles Ziel umgedeutet, was die realen Risiken der individuellen, unüberwachten Einnahme verschleiert.
Die Risiken: Die unbestreitbare Gefährlichkeit von Lithium
Während das Potenzial von niedrig dosiertem Lithium auf faszinierender, aber vorläufiger Forschung beruht, sind die Gefahren von Lithium, insbesondere bei unsachgemäßer Anwendung, unbestreitbar und seit Jahrzehnten klinisch dokumentiert. Die Vermarktung als harmloses Nahrungsergänzungsmittel steht in krassem Widerspruch zu seinem pharmakologischen Profil als hochpotente Substanz mit erheblichen Risiken.
Auf Messers Schneide: Der enge therapeutische Grat
Das größte Risiko bei der Anwendung von Lithium ist sein sogenannter enger therapeutischer Index oder therapeutisches Fenster. Dieser Begriff beschreibt den Umstand, dass der Abstand zwischen der Dosis, die eine erwünschte Wirkung zeigt, und der Dosis, die toxische (giftige) Effekte hervorruft, extrem klein ist.11 Schon geringfügige Änderungen der Konzentration im Blut können den schmalen Grat zwischen Therapie und Vergiftung überschreiten.
Die Symptome einer Lithium-Toxizität sind schwerwiegend und können je nach Art der Überdosierung variieren:
- Akute Toxizität: Tritt bei einer einmaligen hohen Dosis auf. Sie beginnt oft mit Magen-Darm-Beschwerden wie starker Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Im weiteren Verlauf entwickeln sich neurologische Symptome, die von Schwindel, Muskelschwäche und grobschlägigem Zittern (Tremor) über Koordinationsstörungen (Ataxie) und verwaschene Sprache bis hin zu Verwirrtheit, Krampfanfällen und Koma reichen können.34
- Chronische Toxizität: Diese Form kann sich schleichend über einen längeren Zeitraum entwickeln, selbst wenn die Blutspiegel im vermeintlich „therapeutischen“ Bereich liegen. Die Symptome sind oft subtiler und umfassen verstärkte Reflexe, undeutliche Sprache und Gedächtnisprobleme. Chronische Toxizität ist besonders heimtückisch, da sie zu permanenten neurologischen Schäden führen kann.19
Aufgrund dieser Gefahr ist bei der medizinischen Anwendung von Lithium eine engmaschige Überwachung des Blutspiegels (Therapeutisches Drug Monitoring) sowie der Nieren- und Schilddrüsenfunktion absolut zwingend.18 Diese lebenswichtige Sicherheitsmaßnahme entfällt bei der unkontrollierten Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel vollständig.
Die Langzeitfolgen: Nieren- und Schilddrüsenfunktion unter Druck
Neben der akuten Toxizität sind die gut dokumentierten Langzeitschäden an Nieren und Schilddrüse ein Hauptgrund zur Besorgnis.
- Nierenschäden: Lithium wird fast ausschließlich über die Nieren ausgeschieden.18 Bei langfristiger Einnahme kann es die Fähigkeit der Nieren, den Urin zu konzentrieren, beeinträchtigen. Dies kann zum sogenannten nephrogenen Diabetes insipidus führen, einem Zustand, der durch extremen Durst und die Ausscheidung großer Mengen verdünnten Urins gekennzeichnet ist.19 Dieser Zustand kann zu Dehydration führen, was wiederum die Lithiumkonzentration im Blut gefährlich ansteigen lässt und einen Teufelskreis in Gang setzt. In einigen Fällen kann die Langzeiteinnahme zu einer dauerhaften chronischen Nierenerkrankung führen.11
- Schilddrüsenfunktionsstörungen: Lithium reichert sich in der Schilddrüse an und kann die Produktion und Freisetzung von Schilddrüsenhormonen erheblich stören.37
- Kropf (Goiter): Eine sichtbare Vergrößerung der Schilddrüse ist die häufigste Nebenwirkung und betrifft bis zu 40–50 % der Patienten unter Langzeittherapie.37
- Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion): Etwa 20–30 % der Patienten entwickeln eine Unterfunktion der Schilddrüse, die zu Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kälteintoleranz und Depression führen kann – Symptome, die ironischerweise jenen ähneln können, gegen die das Lithium ursprünglich eingenommen wurde.20
- Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion): Obwohl seltener, ist auch die Entwicklung einer Überfunktion der Schilddrüse als Folge der Lithiumtherapie dokumentiert.37
Risikobewertung von Lithiumorotat
Befürworter von Lithiumorotat argumentieren häufig, dass es aufgrund der niedrigeren Dosierung sicherer sei und weniger Nebenwirkungen habe.5 Diese Argumentation erzeugt eine trügerische Sicherheit und verschleiert die fundamentalen Risiken.
Eine niedrigere Dosis verringert zwar die Wahrscheinlichkeit einer akuten Vergiftung im Vergleich zu den hohen psychiatrischen Dosen, eliminiert das Risiko jedoch keineswegs. Ein veröffentlichter Fallbericht beschreibt eine Lithium-Toxizität nach der Einnahme von nur 18 Tabletten eines frei im Internet gekauften Supplements, die zu Übelkeit und Zittern führte.41
Viel wichtiger ist jedoch die Erkenntnis, dass die Sicherheit von Lithium nicht allein von der Dosis abhängt, sondern entscheidend von der individuellen Physiologie und der fehlenden medizinischen Überwachung. Faktoren wie Dehydration (z. B. durch Sport, Krankheit oder heiße Witterung), eine salzarme Ernährung, die Einnahme anderer Medikamente (wie bestimmte Schmerzmittel oder Blutdrucksenker) oder eine bereits bestehende, vielleicht unerkannte Nierenfunktionsstörung können die Ausscheidung von Lithium drastisch verringern und zu einer gefährlichen Anreicherung im Körper führen.32
Die Vermarktung von Lithiumorotat als „sicher, weil niedrig dosiert“ ist eine gefährliche Vereinfachung. Sie blendet aus, dass die Langzeitrisiken für Nieren und Schilddrüse bei chronischer, unkontrollierter Einnahme auch bei niedrigeren Dosen völlig unerforscht sind.1 Die niedrige Dosis wird zu einem Verkaufsargument, das genau jene Sicherheitskontrollen ausblendet, die bei einer Substanz mit einem derart engen therapeutischen Fenster und hoher individueller Variabilität absolut essenziell wären.
Das Verbot in der EU: Eine Frage der Sicherheit und des Gesetzes
Die Tatsache, dass Lithiumorotat in den USA als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich ist, während es in der Europäischen Union nicht als solches zugelassen ist, führt oft zu der Annahme, die EU verfolge eine übermäßig restriktive oder willkürliche Politik. Diese Annahme ist jedoch falsch. Die unterschiedliche rechtliche Einstufung ist die direkte und logische Konsequenz der europäischen Gesetzgebung zum Schutz der Verbraucher, die auf einer klaren Trennung zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln basiert.
Nahrungsergänzungsmittel vs. Arzneimittel: Die rechtliche Trennlinie
Um die Situation von Lithium zu verstehen, muss man die grundlegenden Definitionen im EU-Recht kennen:
- Nahrungsergänzungsmittel (NEM): Gemäß der EU-Richtlinie 2002/46/EG sind Nahrungsergänzungsmittel rechtlich als Lebensmittel eingestuft. Ihr Zweck ist es, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Sie enthalten konzentrierte Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe oder sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung.42 Die Verantwortung für ihre Sicherheit liegt primär beim Hersteller.
- Arzneimittel: Ein Arzneimittel ist gemäß dem deutschen Arzneimittelgesetz (AMG), das die EU-Vorgaben umsetzt, ein Stoff oder eine Zubereitung, die zur Heilung, Linderung, Verhütung oder Erkennung von Krankheiten bestimmt ist. Entscheidend ist, dass sie eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung entfalten, um physiologische Funktionen wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen.43 Arzneimittel unterliegen einem strengen staatlichen Zulassungsverfahren durch Behörden wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das ihre Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit prüft.45
Der Kern des „Verbots“: Lithium als funktionelles Arzneimittel
Der entscheidende Punkt für die rechtliche Einstufung von Lithium in der EU ist, dass es aufgrund seiner nachgewiesenen Wirkungsweise die Kriterien eines Arzneimittels erfüllt. Es wird als sogenanntes funktionelles Arzneimittel (Funktionsarzneimittel) klassifiziert. Das bedeutet, seine primäre Wirkung beruht nicht auf Ernährung, sondern auf einem direkten Eingriff in die biochemischen und physiologischen Prozesse des Körpers.
Die wissenschaftliche Evidenz hierfür ist überwältigend:
- Pharmakologische Wirkung: Lithium wirkt nicht wie ein Mineralstoff, der einen Mangel ausgleicht. Es greift tief in die Neurochemie des Gehirns ein, indem es Ionenkanäle beeinflusst, die Aktivität von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin moduliert und Schlüsselenzyme wie die GSK-3β hemmt.14 Dies ist die Definition einer pharmakologischen Wirkung.
- Therapeutische Indikation: Lithium ist in Deutschland und der EU offiziell zur Behandlung und Prophylaxe spezifischer Krankheiten zugelassen, darunter bipolare Störungen, schwere Depressionen und Cluster-Kopfschmerzen.14 Eine Substanz, die zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt wird, ist per definitionem ein Arzneimittel.
Aus dieser Klassifizierung ergibt sich eine zwingende rechtliche Konsequenz: Eine Substanz kann nicht gleichzeitig ein Arzneimittel und ein Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel) sein. Da Lithium die Kriterien eines Arzneimittels erfüllt, kann es nicht als Nahrungsergänzungsmittel in Verkehr gebracht werden. Die Verschreibungspflicht in Deutschland, die vom Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht zuletzt 2020 bestätigt und präzisiert wurde, gilt für Lithium und seine Salze unabhängig von der Dosis und unterstreicht diesen Status.10 Das „Verbot“ ist also keine willkürliche Entscheidung gegen Lithiumorotat, sondern die konsequente Anwendung des Arzneimittelrechts zum Schutz der Verbraucher vor einer hochpotenten Substanz, die zwingend einer ärztlichen Diagnose, Dosisfindung und Überwachung bedarf.
Die Rolle der Behörden (EFSA, BfR)
Die regulatorische Landschaft in der EU untermauert diese Einordnung. Die EU-Nahrungsergänzungsmittel-Richtlinie arbeitet mit sogenannten Positivlisten. Nur Vitamine und Mineralstoffe, die explizit in den Anhängen der Richtlinie 2002/46/EG aufgeführt sind, dürfen in NEMs verwendet werden.30 Lithium ist nicht auf dieser Liste.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die für die Sicherheitsbewertung von Lebensmittelzutaten zuständig ist, hat sich ebenfalls mit lithiumhaltigen Quellen befasst. In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2009 konnte die EFSA die Sicherheit von lithium-angereicherter Hefe als Nahrungsergänzungsmittel nicht bewerten, da die vom Antragsteller vorgelegten Daten unzureichend waren.48 Wie bereits erwähnt, äußerte die Behörde zudem Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Orotsäure selbst.21
In Deutschland gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Empfehlungen für Höchstmengen von Vitaminen und Mineralstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln ab, um eine sichere Aufnahme zu gewährleisten.49 Für Lithium existiert keine solche Empfehlung, da es aufgrund seiner Einstufung als Arzneimittel nicht in den Zuständigkeitsbereich für Lebensmittel fällt.
Zusammenfassend ist die rechtliche Situation in der EU eindeutig und wissenschaftlich begründet. Die pharmakologische Potenz und die damit verbundenen Risiken klassifizieren Lithium als Arzneimittel und schließen eine Vermarktung als frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel aus.
Fazit und Expertenempfehlung
Die Auseinandersetzung mit Lithium als potenziellem Nahrungsergänzungsmittel offenbart eine tiefe Kluft zwischen vielversprechender wissenschaftlicher Forschung und den realen Gefahren einer unkontrollierten Anwendung. Die präklinischen Studien zu den neuroprotektiven und die epidemiologischen Daten zu den stimmungsstabilisierenden Effekten von niedrig dosiertem Lithium sind wissenschaftlich faszinierend und rechtfertigen weitere Forschung.8 Sie befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium und können keinesfalls als Grundlage für eine Selbstmedikation dienen.
Die Vermarktung von Lithiumorotat als harmloses und sicheres Nahrungsergänzungsmittel ist irreführend und potenziell gefährlich. Sie ignoriert systematisch die potente pharmakologische Wirkung der Substanz, ihren extrem engen therapeutischen Grat, die gut dokumentierten Langzeitrisiken für Nieren und Schilddrüse und die völlig unzureichende Datenlage zur Sicherheit von Lithiumorotat selbst, insbesondere bei chronischer Einnahme.1
Die rechtliche Einstufung von Lithium als verschreibungspflichtiges Arzneimittel in der Europäischen Union ist daher keine willkürliche Schikane, sondern eine notwendige und wissenschaftlich begründete Verbraucherschutzmaßnahme. Sie leitet sich direkt aus den belegten pharmakologischen Eigenschaften von Lithium ab und trägt der Tatsache Rechnung, dass die Anwendung einer solch potenten Substanz zwingend eine ärztliche Diagnose, eine individuelle Dosisfindung und eine engmaschige Überwachung erfordert, um schwere gesundheitliche Schäden zu vermeiden.10
Aus diesen Gründen lautet die abschließende und unmissverständliche Empfehlung:
Es wird eindringlich davon abgeraten, Lithiumprodukte – unabhängig von ihrer chemischen Form (Carbonat, Orotat etc.) oder der beworbenen Dosierung – auf eigene Faust aus dem Internet oder anderen Quellen zu beziehen und ohne ärztliche Aufsicht einzunehmen.
Personen, die unter psychischen oder kognitiven Beschwerden leiden, sollten unbedingt einen qualifizierten Arzt oder Facharzt konsultieren. Nur im Rahmen einer professionellen medizinischen Betreuung kann eine sichere, evidenzbasierte Diagnose gestellt und eine Therapie eingeleitet werden, die den individuellen Nutzen gegen die bekannten Risiken sorgfältig abwägt. Die eigene Gesundheit ist zu wertvoll, um sie unregulierten Produkten und unbelegten Versprechungen anzuvertrauen.
Leider werden solche Produkte in perfekter Werbe-Aufmachung mit angeblichen Fakten aufbereitet über Tiktok und Insta-Account vertrieben. Das war auch mein Grund, diese Recherche zu erstellen.
Mit besorgten Grüßen
Euer Krischan
Referenzen:
- Comparing Lithium Orotate and Prescription Lithium for Bipolar Disorder, Zugriff am Juli 11, 2025, https://footprintstorecoverymh.com/comparing-lithium-orotate-and-prescription-lithium-for-bipolar-disorder/
- A new look at an old drug: neuroprotective effects and therapeutic …, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4946830/
- Neuroprotective Effects of Lithium: Implications for the Treatment of Alzheimer’s Disease and Related Neurodegenerative Disorders – PMC – PubMed Central, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4063497/
- Understanding the Differences Between Lithium and Lithium Orotate – Amen Clinics, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.amenclinics.com/blog/understanding-the-differences-between-lithium-and-lithium-orotate/
- Lithium Orotate Changed My Life: A Journey to Improved Mental Wellness – BRC Recovery, Zugriff am Juli 11, 2025, https://brcrecovery.com/blogs/lithium-orotate-changed-my-life/
- Is Lithium a Micronutrient? From Biological Activity and Epidemiological Observation to Food Fortification – PubMed Central, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6443601/
- Is Lithium a Micronutrient? From Biological Activity and Epidemiological Observation to Food Fortification – PubMed, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30066063/
- A Survey Exploring People’s Experiences With Lithium Bought as a Supplement: Une enquête sur l’expérience des personnes avec le lithium en supplément – PMC, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11954165/
- Lithium orotate (Monohydrate), 99.9%+, food grade (C5H3LiN2O4) – profipyro.de, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.profipyro.de/Lithium-orotate-Monohydrate-999-food-grade-C5H3LiN2O4
- Lithiumorotat – Wikipedia, Zugriff am Juli 11, 2025, https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumorotat
- Lithium Orotate vs Lithium Carbonate: Comparing Forms of Lithium Supplementation – BRC Recovery, Zugriff am Juli 11, 2025, https://brcrecovery.com/blogs/lithium-orotate-vs-lithium-carbonate/
- What is the effect of Lithium (lithium carbonate) orotate? – Dr.Oracle AI, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.droracle.ai/articles/118092/lithium-oratate
- Niedrigdosierte Lithium-Therapie – Dr. Kirkamm, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.dr-kirkamm.de/untersuchung/lithium-therapie
- Lithium – Anwendung, Wirkung, Nebenwirkungen – Gelbe Liste, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Lithium_41883
- Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht Empfehlung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) – BfArM, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Gremien/Verschreibungspflicht/82Sitzung/anlage8.pdf?__blob=publicationFile
- Lithium (medication) – Wikipedia, Zugriff am Juli 11, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_(medication)
- Lithium orotate – Wikipedia, Zugriff am Juli 11, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_orotate
- Lithium in General Practice – bpac NZ, Zugriff am Juli 11, 2025, https://bpac.org.nz/magazine/2007/february/pdfs/bpj3_lithium_pages16-27.pdf
- Complex Lithium Toxicity Despite Normal-Range Serum Lithium Levels | Psychiatric News, Zugriff am Juli 11, 2025, https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2025.03.3.6
- Lithium side effects: Long term and short term – MedicalNewsToday, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.medicalnewstoday.com/articles/326516
- EFSA – SEFAP, Zugriff am Juli 11, 2025, http://www.sefap.it/farmacovigilanza_news_200909/inal653.pdf
- Lithium orotate is more potent, effective, and less toxic than lithium carbonate in a mouse model of mania | bioRxiv, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.01.490227v1.full
- Lithium and neuroprotection: a review of molecular targets and biological effects at subtherapeutic concentrations in preclinical models of Alzheimer’s disease, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12065699/
- Lithium and neuroprotection: translational evidence and implications for the treatment of neuropsychiatric disorders – PMC, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3627470/
- Lithium and neuroprotection: a review of molecular targets and biological effects at subtherapeutic concentrations in preclinical models of Alzheimer’s disease – PubMed, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40348943/
- Lithium in drinking water and suicide mortality – ResearchGate, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/51082171_Lithium_in_drinking_water_and_suicide_mortality
- Lithiumisation of Drinking Water for Suicide Prevention: A Systematic Review, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.suicideinfo.ca/wp-content/uploads/2025/05/lithiumisation_of_drinking_water_for_suicide.101.pdf
- Lithium in drinking water linked with lower suicide rates | King’s …, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.kcl.ac.uk/news/lithium-in-drinking-water-linked-with-lower-suicide-rates
- Relationship between suicide mortality and lithium in drinking water_ A systematic review and meta-analysis – Gwern.net, Zugriff am Juli 11, 2025, https://gwern.net/doc/psychiatry/lithium/2020-barjastehaskari.pdf
- nyheter: Lithium: Anerkennung der Essentialität und Zulassung als Nahrungsergänzungsmittel – online kampanje – openPetition, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.openpetition.de/petition/blog/lithium-anerkennung-der-essentialitaet-und-zulassung-als-nahrungsergaenzungsmittel/2?language=nb_NO.utf8
- Lithium in Drinking Water as a Public Policy for Suicide Prevention: Relevance and Considerations – Frontiers, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2022.805774/full
- Lithium Toxicity – StatPearls – NCBI Bookshelf, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/
- Lithium – DeutschesApothekenPortal, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.deutschesapothekenportal.de/wissen/pharmazeutische-bedenken/kritische-arzneimittelgruppen/lithium/
- Lithium toxicity: MedlinePlus Medical Encyclopedia, Zugriff am Juli 11, 2025, https://medlineplus.gov/ency/article/002667.htm
- Lithium Toxicity: What It Is, Causes, Symptoms & Treatment, Zugriff am Juli 11, 2025, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity
- Lithium for Bipolar Disorder and Risk of Thyroid Dysfunction and Chronic Kidney Disease, Zugriff am Juli 11, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39932712/
- Does Lithium Cause Hypothyroidism? What to Know – Healthline, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.healthline.com/health/does-lithium-cause-hypothyroidism
- How Taking Lithium May Affect Your Thyroid | Paloma Health, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.palomahealth.com/learn/lithium-thyroid
- How Taking Lithium for Bipolar Disease May Affect Your Thyroid – Verywell Health, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.verywellhealth.com/lithium-and-thyroid-disease-3233148
- Lithium Orotate Benefits, Dosage, & Side Effects – Natural Mental Health, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.naturalmentalhealth.com/blog/lithium-orotate
- Lithium toxicity from an Internet dietary supplement – ResearchGate, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/5776546_Lithium_toxicity_from_an_Internet_dietary_supplement
- Food supplements – EFSA – European Union, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-supplements
- Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG). § 4 Sonstige Begriffsbestimmungen, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/__4.html
- Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) § 48 Verschreibungspflicht, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/__48.html
- Landesamt für soziale Dienste – Aufgaben der Arzneimittelüberwachung in Schleswig-Holstein gemäß Arzneimittelgesetz (AMG), Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LASD/Aufgaben/Arzneimittelueberwachung/ArzneimittelueberwachungArtikelArzneimittel
- Wie Lithium auf unsere Stimmung wirkt – esanum, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.esanum.de/today/posts/wie-lithium-auf-unsere-stimmung-wirkt
- Lithium im Nährstoff-Lexikon der Klösterl-Apotheke, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.kloesterl-apotheke.de/naehrstoff-lexikon/lithium/
- Inability to assess the safety of lithium-enriched yeast added for …, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1086
- Position/Statement: Initial comments on BfR recommendations for maximum levels for vitamins and minerals in food supplements by Food Supplements Working Group at the BLL (AK NEM) – Lebensmittelverband, Zugriff am Juli 11, 2025, https://www.lebensmittelverband.de/en/federation/positions/ak-nem-initial-comments-bfr-recommendations-maximum-levels